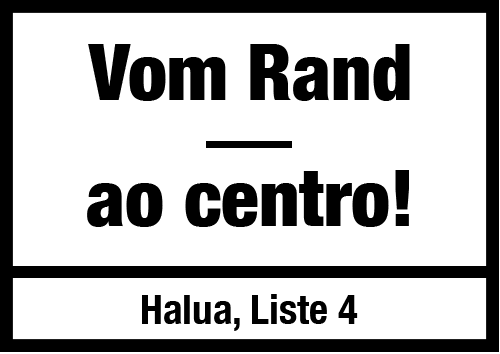Konzept- und kopflose Bürgerrechtsdebatte
Eine zeitgemässe Ausgestaltung des Bürgerrechts wäre eigentlich eine grosse Chance für eine moderne Demokratie. Die politische Realität der Schweiz sieht leider anders aus.
Mal ganz abgesehen davon, dass seit der letzten Totalrevision des Bürgerrechtsgesetz von 1952 einige Jahre vergangen sind, kommt der Vorschlag vom Bundesrat doch sehr bescheiden daher. Es geht ihm dabei auch hauptsächlich um eine Harmonisierung behördlicher Abläufe, eine Neukonzipierung wurde nicht angedacht. Dennoch hat es sich die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat in der Frühjahressession nicht nehmen lassen, die Hürden im Einbürgerungsverfahren weiter auszubauen – völlig entgegen der Realitäten des Zeitalters der globalisierten Weltordnung.
Dabei hat die Schweiz im internationalen Vergleich bereits heute strenge Einbürgerungskriterien, was mit unter ein Grund für den relativ gesehen hohen Anteil an Personen mit AusländerInnen-Status darstellt. Auf diesen Umstand wollte aber schon der Bundesrats in seinem Gesetzesentwurf nicht eingehen, weshalb er den Handlungsbedarf lediglich im modernen Mobilitätsverhalten und der Anpassung des Integrationsbegriffs an das Ausländerrecht sieht. Besonders schlecht weg bei dieser Revision kommen wieder mal EinwandererInnen aus Drittstaaten, ihnen wird die Aufenthaltsdauer neu erst nach Erhalt der Niederlassungsbewilligung angerechnet.
Dass mit einer solchen Vorlage keine Parlamentsseite zufrieden zu stellen ist, war natürlich absehbar. Nun haben sich im Nationalrat jedoch Mehrheiten gefunden, welche noch weitergehende Verschärfungen der Einbürgerungskriterien verlangen und damit deutlich gemacht haben, dass die Mitbestimmung bestimmter Gruppen in unserer Gesellschaft grundsätzlich nicht erwünscht ist. Auf den ersten Blick mag es vielleicht nicht so erstaunen, dass im heutigen xenophob-aufgeladenen politischen Klima die rechtsbürgerlichen Kräften ihre ewig-gestrigen „Ideale“ durchs Parlament bringen wollen (und können). Es steckt aber mehr als reines politisches Kalkül dahinter, wenn ein Parlament Anliegen unterstützt, welche schlussendlich die Legitimität unserer Demokratie in Frage stellen. Denn bereits heute sind in den grossen Städten über ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung nicht stimm- und wahlberechtigt. Gleichzeitig weisen gesamtschweizerisch gegen 900’000 Personen mit AusländerInnen-Status eine Aufenthaltsdauer auf, mit der sie zumindest gemäss geltenden Bundesvorgaben einen Antrag auf Einbürgerung stellen könnten und trotzdem in ihrem Status verbleiben. Es sind also offensichtlich nicht alleine die formellen Hürden, welche potenzielle NeuschweizerInnen vor einer Einbürgerung abschrecken.
Die nationalrätliche Beratung des Geschäfts veranschaulicht dabei, dass es viel mehr um Symbolpolitik geht, als um eine sach- und lösungsorientierte Debatte. Sinnbildlich dafür steht der Entscheid, auf die Doppelzählung der Teenager-Jahre zu verzichten. Das trifft logischerweise gerade diejenigen Jugendliche, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind, und für die die Schweiz ihre Heimat darstellt. Sie werden mit einer solchen Regelung bei der politischen Partizipation oder auch beispielsweise bei der Lehrstellensuche benachteiligt und werden damit strukturell diskriminiert. Dabei wird die Abgrenzung des Bürgerrechtsstatus jedoch künstlich erhalten. In dieser Debatte kann das als „Einbürgerungsverweigerung“ bezeichnet werden, für den Alltag bedeutet das ganz einfach: man wird zum Ausländer gemacht – und man wird immer wieder und wieder daran erinnert anders zu sein. Wenn beispielsweise jemand tausend mal in seinem Leben freundlich gefragt wird, warum er oder sie so gut deutsch sprechen kann, dann verinnerlicht diese Person auf die Dauer eben nicht zur auserwählten Gruppe der SchweizerInnen zu gehören.
Diese gesellschaftlich etablierten Unterschiede schlagen sich im politischen Diskurs nieder und werden jeweils für nationalistische Begründungen heran gezogen. So wird auf die „Einzigartigkeit“ des Schweizer Bürgerrechts hingewiesen und dessen Erwerb als „Privileg“ bezeichnet. Wobei letzteres (ungewollt) sehr treffend umschreibt, weshalb das Bürgerrecht aus deren Sicht exklusiv bleiben muss: um seine eigenen Privilegien zu verteidigen. Denn schliesslich dient die Unterscheidung von Menschen dazu eine Machtstruktur zu erhalten, in der ein Teil einer Bevölkerung davon profitiert, anderen Gruppen Zugänge zu Ressourcen, zu politischer und kultureller Teilhabe auf Grundlage eben dieser Unterschiede vor zu enthalten.
Wenn wir also unsere Demokratie weiter entwickeln wollen, müssen wir diese Machtstrukturen durchbrechen und den Zugang zur politischen Partizipation allen hier lebenden Menschen ermöglichen. In diesem Prozess wäre als erster politischer Schritt eine abschliessende Harmonisierung des Bürgerrechtsgesetzes wirklich notwendig, doch man hätte zumindest alle Staatsebenen miteinbeziehen müssen. Damit könnten Standards für diskriminierungsfreie Einbürgerungsverfahren geschaffen werden und es müssten zwingend keine Volksabstimmungen über Gesuche an Gemeindeversammlungen mehr möglich sein. Ein weiterer wichtiger rechtsstaatlicher Reformbedarf beinhaltet den Erwerb von Bürgerrechten in die ausschliessliche Kompetenz des Bundes zu stellen, wie das bereits bei der erleichterten Einbürgerung die Regel ist. Schliesslich knüpfen die Rechtsfolgen der Einbürgerung am nationalen Bürgerrecht an und zeigen sich überwiegend auf bundesrechtlicher Ebene. Es versteht sich von selbst, dass Kinder und Kindeskinder von Eingewanderten, automatisch eingebürgert werden sollten und sich das Bürgerrecht vom reinen Abstammungsprinzip lösen muss.
Eine Neukonzipierung des Bürgerrechts ist eigentlich kein grosser Wurf. Im politischen Alltag liegt er jedoch in weiter ferne. Doch ob man will oder nicht, die globale Migration, welche durch globale Ungleichheiten genährt wird, und vor allem die MigrantInnenkinder in der zweiten und dritten Generation, schaffen in den modernen Gesellschaften neue Realitäten. Und niemand kann diese Menschen davon abhalten nach einer Teilhabe am guten Leben zu streben – die Frage ist nur unter welchen Bedingungen: als gleichwertige MitbürgerInnen oder als billige Arbeitskräfte?
Dieser Text erschien im Bulletin Solidarité sans frontières Nr. 2/ Mai 2013